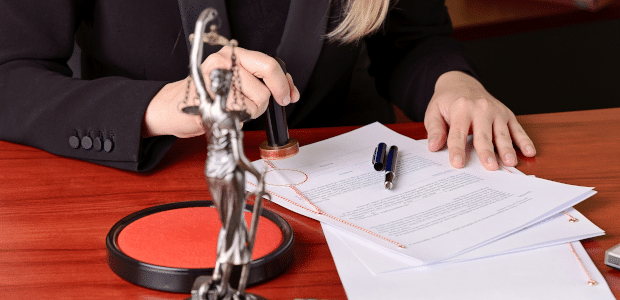Das Gründen einer Stiftung ermöglicht es nicht nur, wohltätige Zwecke zu fördern und die Werte eines Unternehmens über Generationen hinweg weiter bestehen zu lassen. Sie geht ebenfalls mit verschiedenen finanziellen Vorteilen einher: Bspw. kann die Stiftung das Unternehmensvermögen bei Rechtsstreitigkeiten vor dem Zugriff Dritter schützen. Darüber hinaus können Unternehmer, die eine gemeinnützige Stiftung gründen, Steuern einsparen. Welche weiteren Vor- und Nachteile mit einer Stiftung einhergehen, erfahren Sie an dieser Stelle. Wie Sie eine Stiftung gründen können, und welche Voraussetzungen es hierbei zu erfüllen gilt, können Sie hier nachlesen.
Da die Gründung von Stiftungen der Erfüllung unterschiedlicher Zwecke dient, werden diese gemäß ihrer Stiftungsziele, ihrer Finanzierungsform sowie ihrer Rechtsform unterschieden. Zu den bekanntesten Stiftungsarten zählen gemeinnützige Stiftungen sowie Familien- oder Treuhandstiftungen. Eine Übersicht der verschiedenen Stiftungsarten bietet diese Auflistung.
Es existieren keine genauen rechtlichen Vorgaben über die Höhe des Stiftungsvermögens; somit müssen Personen, die eine Stiftung gründen, kein bestimmtes Mindestkapital vorweisen. Die staatliche Aufsichtsbehörde wird allerdings prüfen, ob das eingesetzte Kapital den Stiftungszweck erfüllen kann. Ab welcher Kapitalhöhe die Gründung deshalb erst sinnvoll ist, erfahren Sie hier.
Inhalt
Wie gründet man eine Stiftung?

Die Gründung einer Stiftung unterliegt keinen genauen gesetzlichen Vorgaben. Für eine rechtsfähige Gründung sollten Sie allerdings diesen Ablauf befolgen:
- Bestimmen Sie den Stiftungszweck: Entscheiden Sie, welchen Ziele das Stiftungsvermögen verschrieben wird.
- Legen Sie das Stiftungsvermögen fest: Bestimmten Sie, wie hoch das Kapital sein soll, das Sie für den Stiftungszweck bereitstellen wollen.
- Definieren Sie die Rechtsform der Stiftung: Legen Sie fest entsprechend der Stiftungsziele fest, in welcher Erscheinungsform die Stiftung bestehen soll, und entscheiden diesbezüglich ob Sie bspw. eine gemeinnützige Stiftung oder eine Familienstiftung gründen wollen.
- Setzen Sie Stiftungsgeschäft und Stiftungssatzung auf : Bekunden Sie für das Stiftungsgeschäft Ihren Willen, Ihr Vermögen für die Gründung der Stiftung einzubringen und formulieren Sie die Stiftungssatzung aus.
Um die Stiftung abschließend zu gründen, müssen Sie Stiftungsgeschäft und Stiftungssatzung bei den zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörden urkundlich anerkennen lassen. Die Anerkennung obliegt dem Finanzamt sowie der Stiftungsaufsicht.
Beachten Sie: Der Ablauf der Gründung selbst muss keinem gesetzlich vorgegebenen Prozedere folgen. Gleichwohl ist die Gründung einer Stiftung an bestimmte Voraussetzungen geknüpft.
Stiftung gründen: Rechtliche Voraussetzungen und erforderliche Angaben der Stiftungssatzung
In der Bundesrepublik Deutschland ist generell jede natürliche Person ab 18 Jahren sowie jede juristische Person (bspw. Unternehmen oder rechtsfähige Vereine) dazu berechtigt, eine Stiftung zu gründen. Voraussetzung ist hierbei, dass sie über ein ausreichend hohes stiftbares Vermögen verfügt (s.u.).

Weiterhin gilt die Gründung einer Stiftung als ein sogenanntes Stiftungsgeschäft. Ein Stiftungsgeschäft gilt als ein einseitiges Rechtsgeschäft; es muss stets eine Stiftungssatzung enthalten, die den rechtlichen Rahmen der Stiftung definiert. Demgemäß muss die Stiftungssatzung folgende Angaben enthalten:
- Den Namen des Stifters oder der Stifterin / die Namen der Stifterinnen und Stifter
- Den Namen der Stiftung
- Der Sitz der Stiftung
- Den Stiftungszweck
- Die Rechtsform der Stiftung
- Die Höhe des Vermögens
- Die Begünstigten der Stiftung
- Die vorgesehene Lebensdauer der Stiftung und ggf. die Auflösungsbestimmungen
- Die Stiftungsorgane und -gremien
- Bestimmungen zur Mitgliedschaft und zum Stifterkreis
- Bedingungen etwaiger Satzungsänderungen
Stiftung gründen: Welche Kosten gehen mit einer Gründung einher?

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) bestimmt kein genaues Mindestkapital, das für die Gründung einer Stiftung erforderlich ist. Allerdings muss gemäß § 80 BGB das Kapital bzw. das Stiftungsvermögen ausreichend hoch sein sein, um die „die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks” zu gewährleisten.
Daher genehmigen die staatlichen Aufsichtsbehörden Stiftungsgründungen oftmals ab einem Gründungskapital ab 50.000 Euro oder ab 100.000 Euro. Gemäß der Forderungen vieler Stiftungsbehörden, benötigen Sie in jedem Fall ein Mindestkapital von 25.000 Euro, wenn Sie eine private oder gemeinnützige Stiftung gründen und genehmigen lassen wollen. Weiterhin darf das Gründungsvermögen sich nicht verringern. Es muss daher so angelegt werden, dass es erhalten bleibt und die Finanzierung der Stiftungsarbeit dauerhaft gewährleistet werden kann.
Können Sie eine Stiftung gründen, ohne Kapital zu haben?

Sollten Ihnen kein oder nicht genügend Kapital für die Gründung einer Stiftung zur Verfügung stehen, können Sie zunächst einen zweckgebundenen gemeinnützigen (Förder-)Verein gründen, um das erforderliche Vermögen schrittweise durch Spendeneingänge anzuhäufen. Sobald der Verein das notwendige Stiftungskapital aufgebracht hat, kann dieser nämlich in eine Stiftung übergehen.
Die eingenommenen Spendenzahlungen sind zudem steuerlich absetzbar. Gemäß § 10b Absatz 1 Einkommensteuergesetzes (EStG) dürfen „Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke […] insgesamt bis zu 20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte als Sonderausgaben abgezogen werden.“
Wem gehört das Geld einer Stiftung? Rechtlich gesehen, gehört das Stiftungsvermögen der Stiftung selbst, da diese in aller Regel eine rechtsfähige juristische Person darstellt. Daher gilt die Stiftung als Vermögensinhaberin, der die Verantwortung für Verwaltung und Verwendung des Kapitals gemäß den Bestimmungen der Stiftungssatzung und des Stiftungszwecks untersteht.
Welche Arten von Stiftungen gibt es?
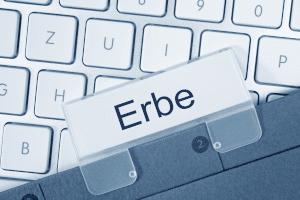
Stiftungen werden angesichts des Stiftungszwecks sowie der Rechtsform, in der sie bestehen, voneinander unterschieden. Folgende Stiftungsarten gehören zu den bekanntesten unternehmensrelevanten Modellen in Deutschland:
- Gemeinnützige Stiftungen: Hierzu zählen alle Stiftungen, die im Sinne von §§ 52 bis 54 (Abgabenordnung) AO gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen. Typischerweise fördert eine Stiftung, die gemeinnützig gründet wurde, etwa Bildungs- und Forschungsprogramme oder ist der Unterstützung bedürftiger Personen gewidmet.
- Privatnützige Familienstiftungen: Diese Stiftungsart ist nicht auf Wohltätigkeit ausgerichtet, sondern sichert das Vermögen einer oder mehrerer Familien und dient demgemäß in erster Linie der Vermögensverwaltung. Personen entscheiden sich üblicherweise dazu eine Familienstiftung zu gründen, um Erbschaftsangelegenheiten zu regeln und das Familienvermögen vor verschwenderischen Ausgaben zu schützen.
- Verbrauchsstiftungen: Die Verbrauchstiftung existiert in Deutschland seit 2013. Sie ist eine die einzige Stiftungsform, bei der das Stiftungsvermögen mit der Zeit aufgebraucht und nicht dauerhaft erhalten wird. Daher bietet es sich an, diese Art der Stiftung zu gründen, wenn Sie den Stiftungszweck voraussichtlich innerhalb von 30 Jahren erfüllen werden.
- Treuhandstiftung: Wenn Sie eine Treuhandstiftung gründen, verwaltet ein ernannter Treuhänder das Stiftungsvermögen im Sinne des Stiftungszweckes zum Nutzen eines oder mehrerer Begünstigter. Treuhandstiftungen werden zumeist eingerichtet, um das Vermögen bestimmter Personen (bspw. Minderjähriger) zu verwalten. Daher gelten Sie auch als unselbständige Stiftungen.
Falls Sie eine Stiftung gründen wollen, um die Unternehmensnachfolge zu sichern, bieten sich insbesondere diese Stiftungsarten an:
- Unternehmensträgerstiftungen: Die Unternehmensträgerstiftung fungiert als Eigentümerin eines Unternehmens und kann dazu beitragen, die Interessen der Eigentümerfamilie zu sichern und die Unabhängigkeit des Unternehmens zu bewahren.
- Beteiligungsträgerstiftungen: Diese Stiftungsart hält Anteile an Personen- oder Kapitalgesellschaften und dienst dazu, die Unternehmensbeteiligungen langfristig zu halten.
- Komplementärstiftung: Diese Stiftungsart fungiert als sogenannter Komplementär in einer Kommanditgesellschaft (KG). Dadurch haftet kein Gesellschafter persönlich, weil die Stiftung das Geschäftsrisiko trägt.
Eine Stiftung gründen: Bestehende Vor- und Nachteile

Eine Stiftung zu gründen, kann verschiedenartige Vorteile mit sich bringen. Hierzu zählen etwa:
- Die Bestimmung der Vermögensverwendung: Ein Stifter oder eine Stifterin kann selbst festlegen, welchen Zwecken (bspw. Wohltätigkeit oder Förderung von Bildung und Wissenschaft) sein oder ihr Vermögen in Zukunft dienen soll.
- Die Nachlassregelung: Personen, die keine Kinder haben, oder diese in der Nachfolge lediglich mit gewissen Pflichten belegen, können Ihren Nachlass mithilfe einer Stiftung regeln.
- Sicherung des eigenen Vermögens: Das Gründungsvermögen bleibt durch die Stiftung erhalten, während ausschließlich mit den daraus entstehenden Einkünften gewirtschaftet wird. Darüber schütz die Stiftung das Vermögen durch den unerlaubten Zugriff Dritter.
- Steuerprivilegien: Wenn Sie eine gemeinnützige Stiftung gründen, profitiert diese von Steuerersparnissen (s.u.)
Gleichzeitig kann die Gründung einer Stiftung ebenso mit gewissen Nachteilen verbunden sein, die Sie vor der Gründung bedenken sollten: Beispielweise haben Sie keinen Zugriff mehr auf Ihr Vermögen, sobald dieses in die Stiftung eingeflossen ist. Zudem können Sie den Eingang des Vermögens in die Stiftung nach dem Vollzug der Gründung in aller Regel nicht mehr rückgängig machen. Eine Wiedererlangung des Gründungkapitals kann grundsätzlich gemäß der in der Stiftungssatzung festgelegten Auflösungsbestimmungen erfolgen.
Darüber hinaus erwirtschaftet eine Stiftung zwar regelmäßige Renditen aus Zinserträgen. Diese sind allerdings den Schwankungen des Geldmarktes unterlegen. Deshalb sollten Sie in Vorbereitung auf mögliche Niedrigzinszeiten immer zusätzliche Anlagemöglichkeiten (bspw. Aktien oder Unternehmensbeteiligungen) bedenken, um die ein ausreichendes Stiftungsvermögen garantieren zu können.
Wann sind Stiftungen steuerbegünstigt?
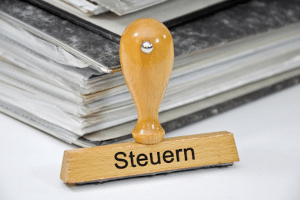
Gemeinnützige Stiftungen, die im Sinne von §§ 52 bis 54 AO sogenannte mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen und „deren Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern“, erhalten zahlreiche Steuerbegünstigungen. Privatnützige Stiftungen (bspw. Familienstiftungen) sind hiervon in aller Regel ausgeschlossen.
Eine Stiftung, die Sie gemeinnützig gründen, wird von folgenden Steuern befreit:
- Der Kapitalertragsteuer
- Der Körperschaftsteuer
- Der Gewerbesteuer (,insofern die Stiftungseinkünfte nicht im Rahmen eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes erzielt werden)
- Der Erbschafts- und Schenkungssteuer
Gut zu wissen: Gemäß der sogenannten Drittelregelung nach § 58 Nr. 6 AO dürfen Personen, die eine Stiftung gründen, bis zu ein Drittel des Einkommens einer steuerbegünstigten Stiftung für eigene Zwecke (bspw. den eigenen Unterhalt sowie den Unterhalt der nächsten Angehörigen) nutzen. Die Eigenverwendung sollte allerdings in „angemessener Weise“ erfolgen.